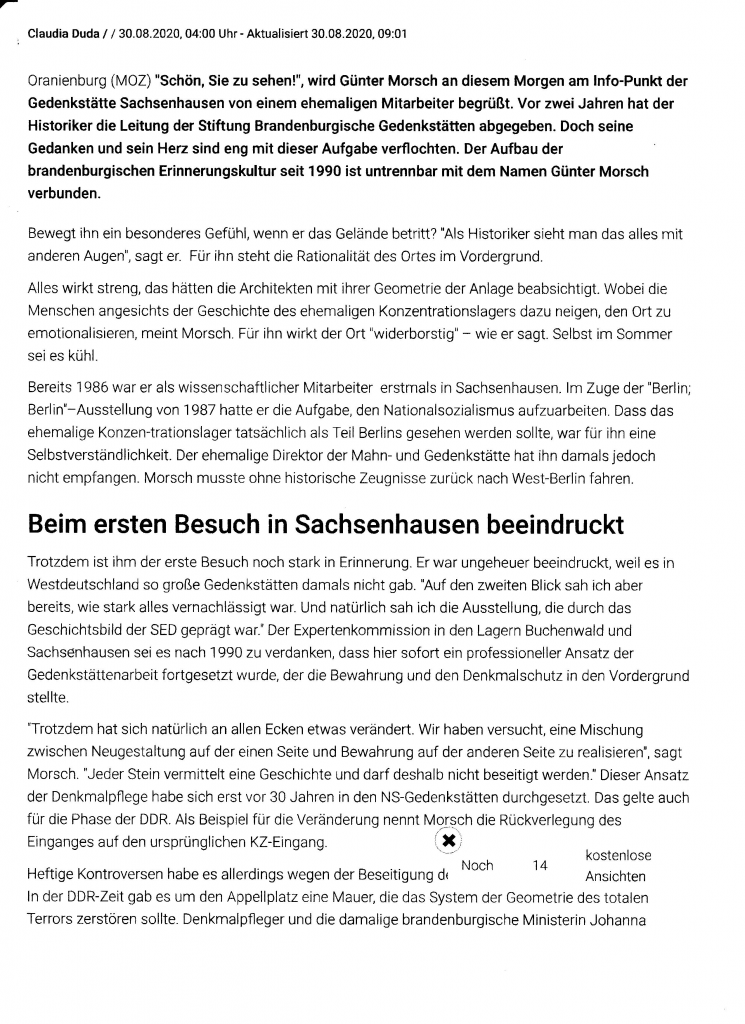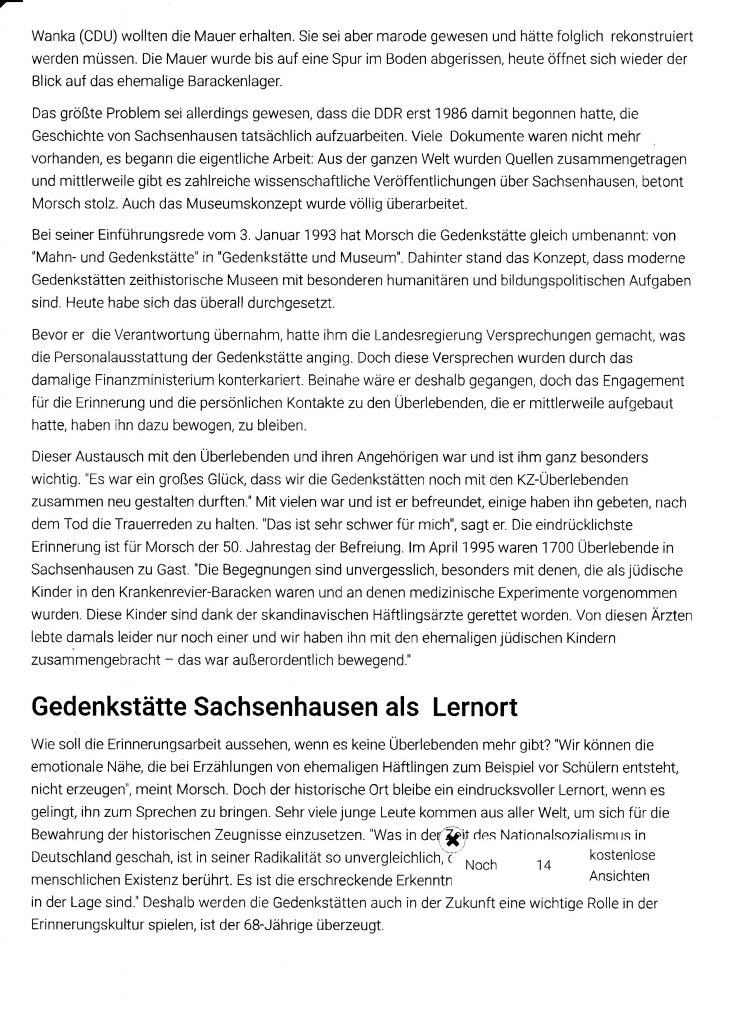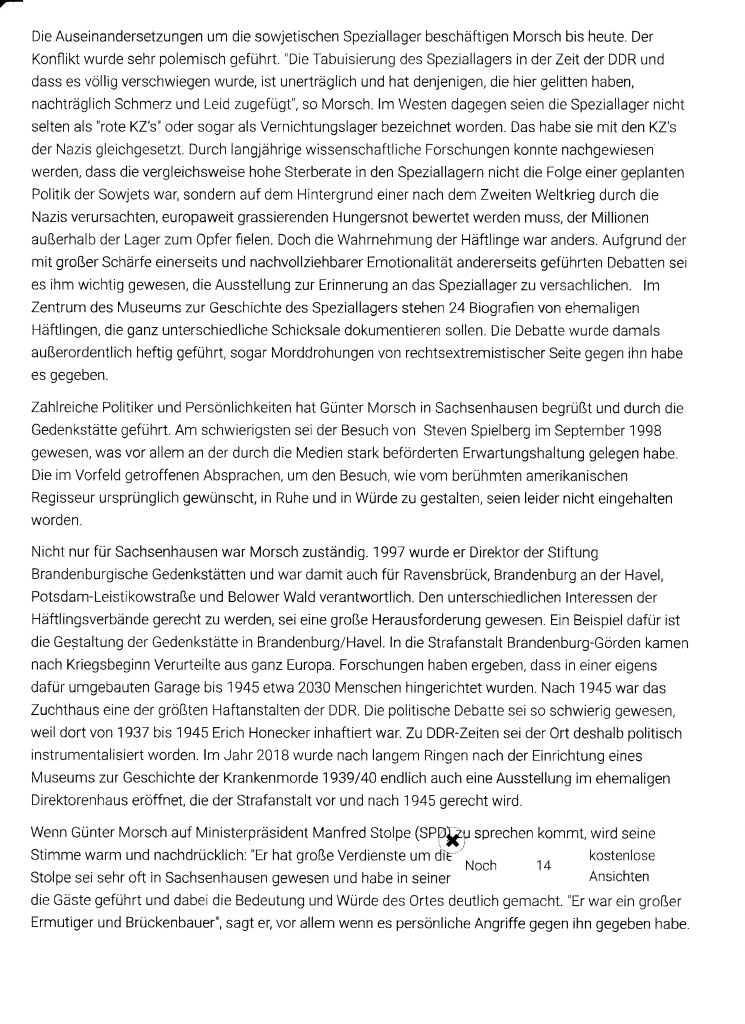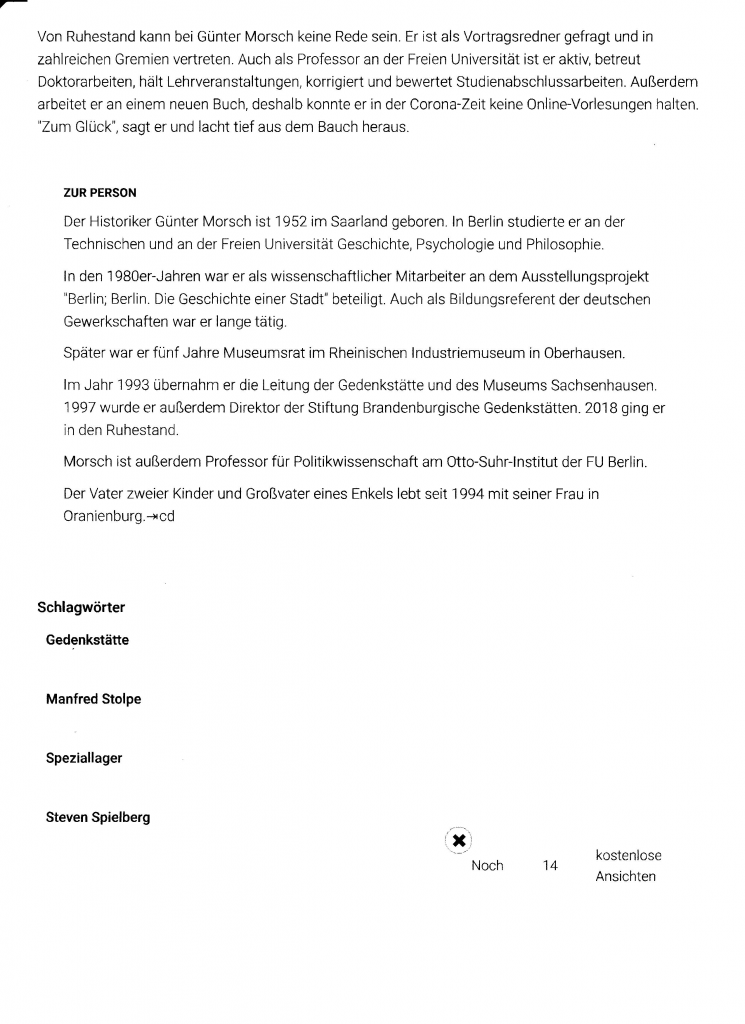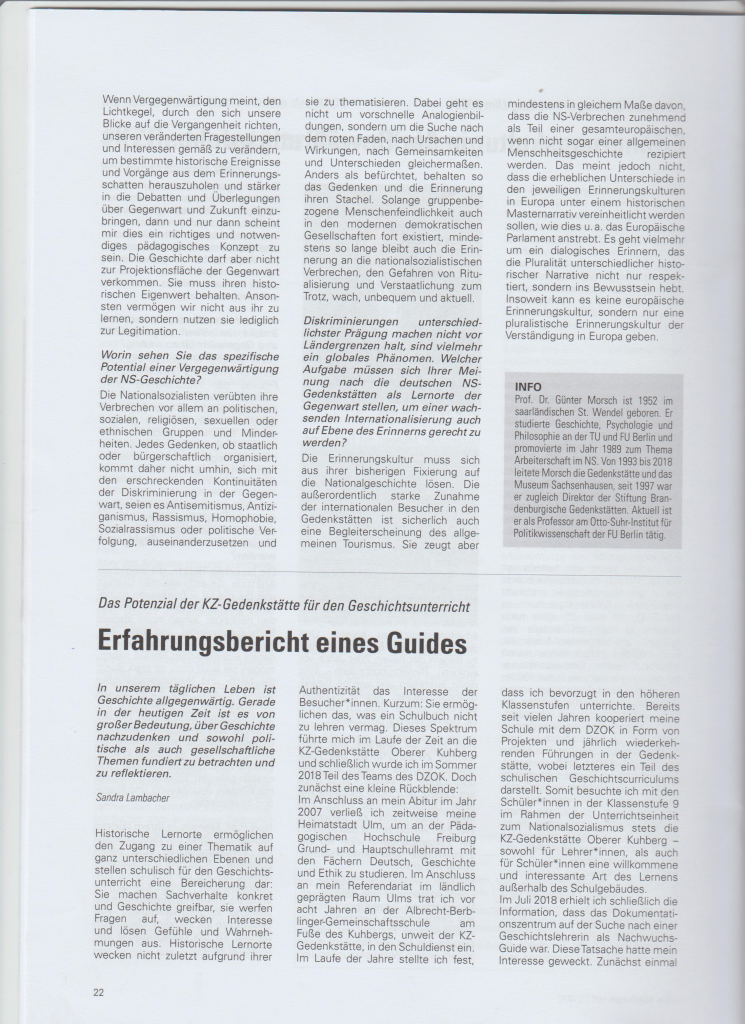Garant für Kontinuität im Wandel: Thomas Lutz als Ratgeber und Vorsitzender des Internationalen Beirats der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 1991-2018
in: 30 Jahre Gedenkstättenreferat der Stiftung Topographie des Terrors, Gedenkstättenrundbrief Nr. 210, 7/2023, S. 64-73
Günter Morsch
Am 30. Januar 1993 gründete die Landesregierung Brandenburg auf der Grundlage eines im Potsdamer Landtag beschlossenen Gesetzes per Verordnung die „rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts ‚Brandenburgische Gedenkstäten‘“(StBG).[1] Sie war die erste rechtlich selbständige Gedenkstättenstiftung der nur gut zwei Jahre zuvor vereinten Bundesrepublik Deutschland. Als Vorbild und Vorläufer kann die vom Land Berlin 1992 errichtete und von ihrem ersten Direktor Reinhard Rürup maßbeglich initiierte und konzipierte „Stiftung Topographie des Terrors“ gelten. Das am Ort der verschiedenen zentralen SS-Dienststellen zunächst provisorisch entstandene Dokumentationszentrum wurde jedoch genauso wie die kurz nach der Brandenburger Einrichtungsverordnung in Thüringen gegründete „Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora“ erst sehr viele Jahre später als rechtsfähige Stiftungen von den jeweiligen Landesregierungen in die Selbständigkeit entlassen. Die in 15 Paragraphen gegossenen maßgeblichen Grundzüge und Prinzipien der brandenburgischen „Stiftungssatzung“ haben die weitere Entwicklung der großen Gedenkstätten in den verschiedenen Bundesländern zweifellos ganz maßgeblich beeinflusst. Fast alle in den folgenden Jahren von den Ländern mit Bundesbeteiligung neu gegründeten Gedenkstättenstiftungen übernahmen zu einem großen Teil die in diesen Paragraphen niedergelegten Strukturprinzipien und Aufgabenbeschreibungen. Dabei lassen sich aus den jeweiligen Abänderungen interessante Aufschlüsse über die geschichtspolitischen Besonderheiten der einzelnen Bundesländer herauslesen. Zuletzt verabschiedete im November 2019 nach jahrelangem Zögern die Hamburger Bürgerschaft das vom Senat vorgelegte Gesetz über die „Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen“. Auch in diesem Text lassen sich leicht wichtige Grundsätze und Ordnungsregeln der brandenburgischen Stiftungsverordnung bis in einzelne Formulierungen hinein wiederfinden.[2]
Die fast drei Jahrzehnte, die seit dem Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur nach der deutschen Einheit vergangen sind, waren mit Debatten und Diskussionen, mit Aufbrüchen und Anfängen, mit Konflikten und Kämpfen sowie mit Verlusten und Veränderungen prall gefüllt. Geschichte scheint sich zeitweilig eine Atempause zu nehmen und dann beschleunigt sie sich plötzlich in einem Atem beraubenden Tempo, bei dem wir, die wir doch als Subjekte die Akteure der Zeitverläufe sind oder zumindest sein sollten, uns eher wie in einem Strudel mitgerissen fühlen. Eine solche Zeit ungeheurer Beschleunigung und Verdichtung haben auch die in der StBG zusammengeschlossenen Gedenkstätten in Brandenburg/Havel, Ravensbrück und Sachsenhausen mit ihrer Außenstelle im Belower Wald erlebt. Blickt man allerdings auf die Entwicklung dieser Jahre zurück, so erstaunt eher die Kontinuität und Beharrlichkeit, in denen die Gedenkstättenstiftung trotz ständiger neuer Herausforderungen den grundlegenden und umfassenden Wandel von den Mahn- und Gedenkstätten der DDR hin zu modernen zeithistorischen Museen mit besonderen humanitären und bildungspolitischen Aufgaben bewältigen konnte.
In solchen Zeiten stürmischen Wandels ist es neben festen Grundsätzen, vorausschauenden, nachhaltigen Konzeptionen und belastbaren Strukturen vor allem das auch über längere Phasen und Brüche hinweg beharrliche Wirken von Personen, das unter den wechselnden Umständen von Krisen und Erfolgen Kontinuität zu erreichen vermag. Ein solch wichtiger Garant für Kontinuität im Wandel war für die Einrichtungen der StBG Thomas Lutz. Schon als Mitglied der 1991 von der Brandenburgischen Landesregierung einberufenen Expertengruppe war der Gedenkstättenreferent der „Stiftung Topographie des Terrors“ an der Erarbeitung eines umfangreichen Gutachtens beteiligt. Darin ging es um nichts weniger als um Empfehlungen zur umfassenden Neukonzeption der brandenburgischen Gedenkstätten. Unter dem Vorsitz des Bochumer Historikers Bernd Faulenbauch berieten sieben Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten auf der Grundlage einer kritischen Aufarbeitung der Rolle des Antifaschismus und der Mahn- und Gedenkstätten in der DDR über die Modernisierung, Neukonzeption und Umgestaltung der ehemaligen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten im neu gegründeten Bundesland Brandenburg. Für die Berufung von Thomas Lutz in die Brandenburgische Expertenkommission sprach vor allem seine damals schon herausragende Kenntnis der nationalen und internationalen Gedenkstätten, das Vertrauen, das er durch seine Tätigkeit bei den Organisationen der Überlebenden erworben hatte sowie seine profunde Expertise insbesondere im Bereich der Gedenkstättenpädagogik.
Nicht als Gedenkstättenreferent, sondern als offizieller Vertreter der gerade auch im Ausland anerkannten „Aktion Sühnezeichen“ wählten die im Herbst 1993 von den Organisationen der Überlebenden und den Betroffenenverbänden delegierten fast 20 Mitglieder des Internationalen Beirates Thomas Lutz auf ihrer ersten Sitzung einstimmig zu ihrem Vorsitzenden. In dieser wichtigen Funktion trug der Vorsitzende des Internationalen Beirates, der zumeist in zwei Arbeitskommissionen tagte, die Stimmen und Voten der Überlebenden des NS-Terrors ebenso wie der Opfer der sowjetischen Geheimpolizei und der SED-Diktatur in den Stiftungsrat. Als einer von sieben voll stimmberechtigten Mitgliedern entschied der Beiratsvorsitzende in diesem Gremium über grundsätzliche Fragen der Stiftungsentwicklung, wie vor allem über Fragen des Haushaltes, der Organisation und Personalausstattung. Zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, vertreten durch seinen Präsidenten Ignatz Bubis und den Gedenkstättenreferenten Peter Fischer, und dem Vorsitzenden der Fachkommission Bernd Faulenbach sah sich der Beiratsvorsitzende nicht selten in die Rolle gedrängt, die berechtigten Anliegen der Gedenkstätten gegenüber den finanziellen und politisch motivierten Bedenken und Einwänden der Beauftragten von Land und Bund, an ihrer Spitze die jeweiligen brandenburgischen Kulturministerinnen und Kulturminister, nachdrücklich zu unterstützen. In einer Zeit, in der relativ große Finanzmittel zur Restauration und Umgestaltung der historisch-authentischen Gelände mit zahlreichen, teilweise im Verfall begriffenen denkmalgeschützten Gebäuden dringend erforderlich waren, während zugleich die kontinuierliche Schrumpfung der staatlichen Ausgaben von maßgeblichen Teilen der Politik schon aus Gründen volkswirtschaftlicher Dogmatik angestrebt wurde, galt es allerdings auch vielfältige Konfliktlagen und Konfrontationen auszuhalten und durchzustehen. Wie sehr auch die Mitglieder des Internationalen Beirates ihrem Vorsitzenden sein konsequentes Eintreten für die Belange der Opferverbände und der Gedenkstätten, seine Beharrungskraft, seine Argumentationsstärke und sein diplomatisches Geschick schätzten, lässt sich allein schon aus der regelmäßigen, alle vier Jahre vorgenommenen und einmütigen Wiederwahl von Thomas Lutz in den fast drei Jahrzehnten seit 1993 erschließen.
Dabei konnte von Zusammenhalt und Einigkeit der Opfer- und Betroffenenverbände untereinander sowie von Vertrauen in die neuen Gedenkstättenleitungen vor Beginn der Stiftungsgründung keine Rede sein. Die durch die friedliche Revolution bewirkten politischen und erinnerungskulturellen Friktionen und Konfrontationen hatten auch die Mahn- und Gedenkstätten erfasst. Deren Praxis des instrumentalisierten Antifaschismus schlug zu Recht heftige Kritik und Forderungen nach sofortigen Änderungen entgegen. Das nicht immer sensible Verhalten der 1989/90 neu eingesetzten Kulturverwaltungen sowie der kommissarischen Gedenkstättenleitungen verschärfte die Konflikte. Misstrauen auf allen Seiten machte sich breit und führte zu heftigen gegenseitigen Angriffen und Vorwürfen, die in Einzelfällen auch physisch ausgetragen wurden. Von heute aus betrachtet sollte man die damaligen erregten Proteste, die die NS-Opferverbände ebenso wie große Teile der Öffentlichkeit erfassten, vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs eines alle Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts erfassenden Systemwechsels bewerten. Denn die „Tempel des Antifaschismus“ spielten eine wichtige Rolle bei der Legitimierung der DDR-Diktatur. Trotzdem gab es in den ersten Jahren des Übergangs eine Vielzahl von verstörenden Aktivitäten, Maßnahmen, Reden und Veröffentlichungen, die nicht nur die Überlebenden des NS-Terrors teilweise in höchste Erregung oder Depression trieben. Dazu zählten zum Beispiel der sogenannte Supermarkt-Skandal in Ravensbrück, die Umbenennung von Straßen und Schulen im Umfeld der Gedenkstätten, die nach Mordopfern der Nationalsozialisten benannt waren oder die politisch motivierte Schließung von Museen und Ausstellungen. Für nicht wenige Überlebende des NS-Terrors und ihre Angehörigen verdichteten sich alle diese Anzeichen zu einem vermeintlichen „Generalangriff“ auf die Mahn- und Gedenkstätten. Als schließlich Antisemiten und Rechtsextremisten im September 1992 nach dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin einen Brandanschlag auf die sogenannten jüdischen Baracken in Sachsenhausen verübten und dabei nicht nur großen materiellen, sondern auch politischen Schaden anrichteten, schienen sich für viele kritische Beobachter des Prozesses der deutschen Einheit ihre Befürchtungen zu bewahrheiten. Als Folge der Vertrauenskrise zogen Überlebende und ihre Familien ihre Artefakte und Dokumente aus den Archiven der Mahn- und Gedenkstätten ab, andere kehrten den Einrichtungen ihre Rücken zu und boykottierten sogar die Veranstaltungen zu den Jahrestagen der Befreiung.
Auch die sorgfältig erarbeiteten, intensiv recherchierten und differenziert argumentierenden, relativ umfangreichen Empfehlungen der Expertenkommission zur Neukonzeption der brandenburgischen Gedenkstätten, in denen vermutlich Thomas Lutz vor allem die Teile zur Neukonzeption der Gedenkstättenpädagogik maßgeblich beeinflusste,[3] stießen zunächst bei einem Großteil der Verbände auf heftigen Widerspruch. Der spätere Direktor der „Stiftung Topographie des Terrors“ Andreas Nachama sprach sicherlich nicht nur für sich, als er auf dem nach der Vorlage der Empfehlungen im März 1992 veranstalteten Colloquium den Programmverantwortlichen das „Misstrauen“ aussprach. Ein Dialog mit den Verfolgtenverbänden, so führte er aus, sei überhaupt nicht angestrebt worden und die Veranstaltung habe nur „Alibicharakter“.[4] Hauptsächlich aber kritisierte er die Empfehlungen der Kommission zum Umgang mit der zweifachen Vergangenheit in Sachsenhausen, als Konzentrationslager und als sowjetisches Speziallager. Wenn man deren Vorschlägen folgen wolle, sei es besser, „alle Anlagen zu schleifen und einen Gedenkhain anzulegen.“[5] Die von Nachama und anderen Vertretern der NS-Opfer, wie der Sprecherin der VVN-BdA Rosel Vadehra-Jonas, geäußerten Befürchtungen, dass es in den Brandenburgischen Gedenkstätten, insbesondere in Sachsenhausen, zu einer undifferenzierten Vermengung der beiden historischen Phasen vor und nach 1945 und damit zu einer Relativierung der NS-Verbrechen kommen könnte, waren im Hinblick auf die allgemeine politische Entwicklung in Deutschland und in Europa nicht unbegründet. Selbst das Europa-Parlament wandte sich deshalb mit einer entsprechenden Ermahnung an die internationale Öffentlichkeit.[6] Die Empfehlungen der Expertenkommission aber richteten sich eher im Gegenteil gegen solche Tendenzen, „braune“ und „rote“ Diktaturen, wie Nationalsozialismus und SBZ/DDR gelegentlich bezeichnet wurden, gleichzusetzen.
Vertreter der kommunistischen Opferverbände reklamierten zugleich energisch eine gleichwertige Berücksichtigung ihrer Leiden. „Opfer erster“ und „zweiter Klasse“, so ihre moralisch zweifellos berechtigten Appelle, dürfe es nicht geben. Doch viele ihrer Vorstellungen zur Zukunft der brandenburgischen Gedenkstätten gingen weit darüber hinaus. Im Sinne einer Publikation des späteren Vorsitzenden der „Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft“ (UOKG) und Überlebenden des sowjetischen Speziallagers Buchenwald Gerhart Finn[7] verlangten sie ein einheitliches Museum in Sachsenhausen, in dem „unter einem Dach“ über die Geschichte zwischen 1936 und 1950 informiert werden sollte, da es nur ein Konzentrationslager gegeben hätte.
Die in den Empfehlungen der Expertenkommission ausgeführte, später nach ihrem Vorsitzenden benannte „Faulenbach-Formel“ [8] löste zwar die unterschiedlichen historischen Einschätzungen über den Charakter der sowjetischen Speziallager nicht auf, aber sie trug dazu bei, einen Boykott der neu zu gründenden Gedenkstättenstiftung durch Opferverbände zu verhindern und bot eine Plattform für Verständigung und Gespräche. Erst danach aber kamen „die Mühen der Ebenen“ und diese zu bewältigen, war neben den Vertretern der Gedenkstättenstiftung eine der Hauptaufgaben, vor allem auch von Thomas Lutz. Laut Einrichtungsverordnung nämlich vertrat der Beiratsvorsitzende alle in diesem Beratungsgremium vertretenen bis zu 20 Opfer- und Interessenverbände. Es war neben der Stiftungsleitung vor allem seine Aufgabe, mit den anfänglich in zwei getrennten Räumen am Sitz der Stiftung im ehemaligen Verwaltungsgebäude der KZ-Inspektion gegründeten und zumeist zu unterschiedlichen Zeiten zweimal jährlich tagenden Arbeitskommissionen des Beirates, die sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte vor oder nach der Befreiung vom Nationalsozialismus befassten, gemeinsame Initiativen auszuhandeln und die mühsam geknüpften Gesprächsfäden zu pflegen und zu bewahren. Anders aber als erhofft, wurde die Verständigung und Kommunikation zwischen den beiden Kommissionen nicht einfacher, als im Sommer 1994 ein neuer Vorstand der „Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945–50“ gewählt wurde. Zumindest eine Mehrheit im Vorstand und ein großer Teil der Mitglieder trat danach immer offener für revisionistische Positionen ein, lud Rechtsextremisten als Redner zu ihren Veranstaltungen ein und rief zu einer Gedenkveranstaltung für den Kindermassenmörder und T4-Gutachter Professor Hans Heinze auf.
Da Thomas Lutz allerdings zumindest im Stiftungsrat die Gesamtinteressen des Beirates zu vertreten hatte, war dies ein schwieriger Balanceakt, den er jedoch aufgrund seiner herausragenden dialogischen Kommunikationsstärke zumeist mit großem Erfolg bewältigte. Dabei kam ihm zu Hilfe, dass die vier aufeinander folgenden Vorsitzenden der Arbeitskommission zur Geschichte der Speziallager und der kommunistischen Verfolgung, Ulf Müller, Horst Jänichen, Kurt Noak und Hans-Joachim Schmidtchen, die als nicht stimmberechtigte Mitglieder an den Beratungen des Stiftungsrates teilnahmen, sich gleichfalls um eine Verständigung bemühten. Die vier Verfolgten der sowjetischen Geheimpolizei und der DDR-Diktatur, die in den Gefängnissen Bautzen und Hohenschönhausen sowie in den sowjetischen Speziallagern Sachsenhausen und Jamlitz gelitten hatten, bemühten sich gemeinsam mit Thomas Lutz darum, zu den im Beirat vertretenen NS-Opferorganisationen Brücken zu schlagen und vereinzelt auch persönliche Freundschaften zu knüpfen. Durch das bald schon aufgebaute Vertrauensverhältnis zwischen ihnen gelang es zwar nicht, die grundlegenden Differenzen und Meinungsunterschiede abzubauen. Trotzdem konnte Thomas Lutz alle Beiratsmitglieder davon überzeugen und dabei durchsetzen, dass wichtige Grundsatzentscheidungen der Gedenkstättenstiftung an bestimmten Wegmarken teils in gemeinsamen Beratungen oder zumindest in Übereinstimmung getroffen wurden. Übereinstimmung konnte dabei zum Beispiel in der Frage des für die Umgestaltung der Gedenkstätte Sachsenhausen grundlegenden dezentralen Gesamtkonzeptes erzielt werden. Der schon Ende 1994 den Stiftungsgremien vorgelegte und einstimmig angenommene Plan beendete den ursprünglichen Streit um die Frage eines alle historischen Phasen umfassenden Museums, indem er vorschlug, mehrere kleine Ausstellungen an bestimmten historischen Schauplätzen des historischen Areals einzurichten und sie mit der konkreten Geschichte des jeweiligen Ortes zu verknüpfen. Das große Museum zur Geschichte der Speziallager sollte demnach, einen Vorschlag der Expertenkommission aufgreifend, an der Schnittstelle zwischen den beiden Lagerzonen I und II des sowjetischen Speziallagers errichtet werden.[9] Zugleich aber enthalten alle dezentralen Ausstellungen einen einleitenden Teil, in dem alle historischen Phasen zwischen 1936 und 1989 kurz dargestellt werden. Auch der aus dem inhaltlichen und gestalterischen dezentralen Gesamtkonzept folgenden baulichen Zielplanung stimmten in einer gemeinsamen Beiratssitzung 1996 alle Mitglieder beider Kommissionen zu.[10]
Auf der Grundlage pauschaler Kostenschätzungen über die notwendigen Finanzmittel zur Restauration, zum Erhalt und zum Umbau der historischen Orte in Brandenburg/Havel, Ravensbrück und Sachsenhausen verlangten die Mittelgeber die Aufstellung eines für zehn Jahre gültigen Rahmeninvestitionsplans. Dieser sah innerhalb eines Gesamtrahmens von maximal 30 Millionen DM den Neubau eines Museums zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers erst in den Jahren 2003–2006 vor.[11] Thomas Lutz gelang es daraufhin, auch die Mitglieder der Arbeitskommission für die Geschichte des NS-Terrors von der Notwendigkeit zu überzeugen, gegen diesen Zeitplan zu votieren und eine zeitliche Vorverlegung der Errichtung des Speziallagermuseums zu fordern. Auch als daraufhin Ende der neunziger Jahre ein internationaler Wettbewerb stattfand, als dessen Ergebnis der preisgekrönte Entwurf des Frankfurter Büros Schneider und Schumacher ausgewählt wurde, gelang es dem Beiratsvorsitzenden, beide Arbeitskommissionen auf einer gemeinsamen Tagung in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück für die von der Stiftungsleitung vorgeschlagene Realisierung dieses an der Nordspitze des Lagerdreiecks geplanten und mit original erhaltenen, in der KZ-Zeit gebauten Steinbaracken verbundenen Neubaus zu gewinnen. Beide Beiratskommissionen sprachen sich zugleich ohne Gegenstimmen für die von der Gedenkstättenleitung vorgelegte Ausstellungskonzeption aus.[12]
Natürlich war das Vermittlungsgeschick des Beiratsvorsitzenden, der zugleich auch die Tagungen der Arbeitskommission zur Geschichte der NS-Verfolgung leitete, auch in der Vermittlung anderer Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlicher Sichtweisen gefragt, die nicht mit dieser sicherlich schwierigsten Problemlage der Stiftungspolitik in Brandenburg zusammenhängen. Einige weitere Beispiele finden sich im Artikel von Peter Fischer in der vorliegenden Publikation. Da hier leider nicht der Platz ist, dieses vielfältige und zumeist erfolgreiche Wirken des Beiratsvorsitzenden näher auszuführen, will ich nur kurz darauf verweisen, dass es vor allem auch dem Vorsitzenden zu verdanken ist, wenn der Präsident des Internationalen Sachsenhausenkomitees Pierre Gouffault im Zuge der Wiederwahl von Thomas Lutz im Juni 1998 im Rahmen einer bewegenden persönlichen Erklärung das „kooperative Arbeitsklima in der Beiratskommission“ würdigte.[13] Für das wachsende Vertrauen der Überlebenden von KZ und Gefängnishaft in die Erinnerungskultur Deutschlands im Allgemeinen und die Einrichtungen der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung im Besonderen trugen zu einem wichtigen Teil sicherlich auch die großen Veranstaltungen zu den runden Jahrestagen der Befreiung bei, zu denen zahlreiche Überlebende kamen. Insbesondere 1995, zum 50. Jahrestag der Befreiung, kamen auf Einladung der Landes- und Bundesregierungen sowie der Stiftung insgesamt ca. 3.400 Überlebende teilweise erstmals an die Orte der Verbrechen und ihrer Leiden zurück. In seiner Bilanz des Verlaufs der Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Befreiung schrieb Thomas Lutz: „Die Durchführung des 50. Jahrestages mit zahlreichen Begleitveranstaltungen war ein Erfolg: Für die Überlebenden, die häufig zum zweiten Mal – diesmal eingeladen und freiwillig – nach Deutschland gekommen sind, war dies sowohl eine große gesellschaftliche Anerkennung als auch eine Möglichkeit, sich persönlich mit ihrem Schicksal auseinanderzusetzen. Diese humanitäre Leistung von deutscher Seite wurde in der ganzen Welt sehr dankbar angenommen.“[14]
Seine bereits im Titel des Beitrags, „Ende eines Gedenkjahres – Was bleibt?“, zugleich ausgesprochenen Bedenken und Befürchtungen hinsichtlich der Gefahren einer selbstzufriedenen Erinnerungskultur in Deutschland verstärkten sich in den Jahren danach eher. Trotzdem lobte Thomas Lutz auch zehn Jahre später die umfangreiche Weiterentwicklung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, „der von den Häftlings- und Betroffenenorganisationen große Anerkennung und hoher Respekt entgegen gebracht wird.“[15] Mit Sorge betrachtete er die auch wegen des politischen Erfolgs nicht nur in Brandenburg zunehmende Tendenz, das fast idealtypische Konstrukt einer inhaltlich unabhängigen Gedenkstättenstiftung, wie es in Brandenburg entwickelt worden war, zu verändern. Als Beiratsvorsitzender war Thomas Lutz der gewählte Repräsentant der Zivilgesellschaft, die zusammen mit den Vertretern einer unabhängigen Wissenschaft die Stiftungs- und Gedenkstättenleitungen in allen inhaltlichen Fragen beraten. Das dadurch institutionalisierte Subsidiaritätsprinzip beschränkte somit die Entscheidungen der politischen Exekutive hauptsächlich auf grundsätzliche Beschlüsse über Fragen der Stiftungsorganisation und des Haushaltes. Spätestens nach dem 60. Jahrestag der Befreiung aber häuften sich die Vorstöße, die darauf abzielten, die bereits in der Expertenkommission zugrunde gelegten Prinzipien der Einrichtungsverordnung der Stiftung zu ändern. Diese zielten zum einen auf eine Erweiterung der inhaltlichen Zuständigkeit der Stiftung im Hinblick auf die Nachkriegsgeschichte mit dem Ziel einer äquivalenten Bewertung der historischen Phasen. Zum zweiten sollte die Bedeutung der Beratungsgremien geschwächt und im Gegenzug die Entscheidungen der Exekutive im Sinne einer größeren inhaltlichen Kompetenz des Stiftungsrates verstärkt werden. Schließlich gab es zum dritten Überlegungen, die Kompetenzen des Stiftungsvorstandes und der Gedenkstättenleitungen mit der Begründung der Einführung eines „Kollegialprinzips“ zugunsten der Verwaltungsleitung abzuschwächen. Ähnliche „Reformvorschläge“, denen Gutachten von privaten Beratungsfirmen und dem Bundesverwaltungsamt zugrunde lagen, wie zum Beispiel die Befristung der Zeitverträge von Leitungspositionen in den Gedenkstätten, wurden auch in anderen Einrichtungen der Erinnerungskultur betrieben und teilweise durchgesetzt, entsprachen sie doch darüber hinaus dem damaligen neoliberalen Zeitgeist. Parteipolitische Unterschiede waren daher nicht ausschlaggebend, auch wenn die Initiative in Brandenburg von einer konservativen Kulturministerin ausgegangen war.
In dieser mehrjährigen, schwierigen und politisch brisanten Auseinandersetzung konnte sich der Stiftungsvorstand uneingeschränkt auf die Unterstützung des Internationalen Beirats, vertreten vor allem durch seinen Vorsitzenden Thomas Lutz, die Generalsekretärin des Internationalen Sachsenhausenkomitees Sonja Reichert und die Vertreter des Zentralrats der Juden, Stefan Kramer und Peter Fischer, verlassen. Dabei bemühte sich der Beiratsvorsitzende stets um eine enge Abstimmung sowohl mit dem Vorstand als auch den Leitern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Obwohl Thomas Lutz immer dazu bereit war, Erfahrungen, Erfolge ebenso wie Misserfolge, mit allen Beteiligten, auch der politischen Exekutive, ergebnisoffen zu diskutieren, vermochte er keinen Grund zu erkennen, warum die 1992 erstmals von ihm mitformulierten und 1993 in der Einrichtungsverordnung der Gedenkstättenstiftung formulierten Grundsätze und Ordnungsprinzipien abgeschafft oder verändert werden sollten. Es ist mir daher ein Bedürfnis und eine große Freude, Thomas Lutz für diese feste Beharrlichkeit und große Unterstützung im Prozess der Umgestaltung, Modernisierung und Neuorganisation der brandenburgischen Gedenkstätten zu danken. Für die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten war Thomas Lutz ein wichtiger und unverzichtbarer Garant für Kontinuität im Wandel.
Prof. Dr. Günter Morsch, Historiker und Politkwissenschaftler, war von Januar 1993 bis Juni 2018 Leiter von Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen und seit 1997 auch Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.
[1] Die 1. Fassung ist abgedruckt in: Jahresbericht der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für die Jahre 1993 bis 1995, S. 106ff. Sie wurde mehrfach, allerdings ohne entscheidende Veränderungen novelliert.
[2] Das Gesetz ist abgedruckt in: https://www.gedenkstaetten-hamburg.de/fileadmin/shgul/Stiftung/2019.11.08_HmbGVBl__Nr._41_HmbGedenkStG-1.PDF.
[3] Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) Empfehlungen zur Neukonzeption der brandenburgischen Gedenkstätten. Januar 1992, Berlin August 1992.
[4] Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Brandenburgische Gedenkstätten für die Verfolgten des NS-Regimes. Perspektiven, Kontroversen und internationale Vergleiche. Beiträge des internationalen Gedenkstätten-Colloquiums in Potsdam am 8. und 9. März 1992, Berlin 1992, S. 191f.
[5] Ebenda.
[6] Entschließung zum europäischen und internationalen Schutz der Stätten der von den Nationalsozialisten errichteten Konzentrationslager als historische Mahnmale vom 11.02.1993, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft vom 15.03.1993, Nr. C 72/118ff.
[7] Gerhart Finn, Sachsenhausen 1936–1950. Geschichte eines Lagers, Bad Münstereifel 1988.
[8] „Die NS-Verbrechen dürfen weder durch die Verbrechen des Stalinismus relativiert, noch die Verbrechen des Stalinismus mit Hinweis auf die NS-Verbrechen bagatellisiert werden.“ In: B. Faulenbach, Einleitung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (Hrsg.), Perspektiven, Kontroversen, S. 17.
[9] Während das vormalige „Schutzhaftlager“ des KZ von der sowjetischen Lagerverwaltung als Zone I für die Unterbringung von Internierten nach dem Potsdamer Abkommen benutzt wurde, befanden sich in dem nordöstlich anschließenden Areal des ehemaligen KZ-Sonderlagers, das als Zone II bezeichnet wurde, die von Sowjetischen Militärtribunalen Verurteilten. Günter Morsch, Ines Reich (Hrsg.), Sowjetisches Speziallager Nr. 7/Nr. 1 in Sachsenhausen (1945–1950), Berlin 2005 (Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 14).
[10] Günter Morsch, Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen. Von der Baugeschichte zum dezentralen Gesamtkonzept, von der Zielplanung zur Realisierung. Stationen und Umwege eines geradlinigen Entwicklungskonzepts, in: Günter Morsch/Horst Seferens (Hrsg.): Gestaltete Erinnerung. 25. Jahre Bauen in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 1993–2018. Eine Dokumentation, Berlin 2020, S. 45ff.
[11] Günter Morsch, Gestaltete Erinnerung. 25 Jahre Bauen, in: ebenda, S. 37. Zwischen 1993 und 2018 verauslagte die Stiftung für Baumaßnahmen insgesamt 73,2 Millionen Euro.
[12] Jahresbericht der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für das Jahr 1999, S. 82f. Das hinderte aber leider die im Beirat durch ihre Vorsitzende vertretene AG Lager Sachsenhausen 1945–50 nicht, am Tag der Eröffnung des Speziallagermuseums am 9.12.2001 gegen Konzept, Lage und Ausgestaltung des Museums öffentlich zu protestieren.
[13] Jahresbericht der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für das Jahr 1998, S. 62.
[14] T. Lutz, Ende eines Gedenkjahres – Was bleibt? Thesen zur aktuellen und zukünftigen gesellschaftspolitischen Bedeutung und inhaltlichen Arbeit der KZ-Gedenkstätten, in: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (Hrsg.), Erinnerung und Begegnung. Gedenken im Land Brandenburg zum 50. Jahrestag der Befreiung, Potsdam 1996, S. 56ff, hier S. 57.
[15] Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (Hrsg.), 60. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge aus den Konzentrationslagerns Sachsenhausen und Ravensbrück sowie aus dem Zuchthaus Brandenburg, Oranienburg 2005, S. 59.