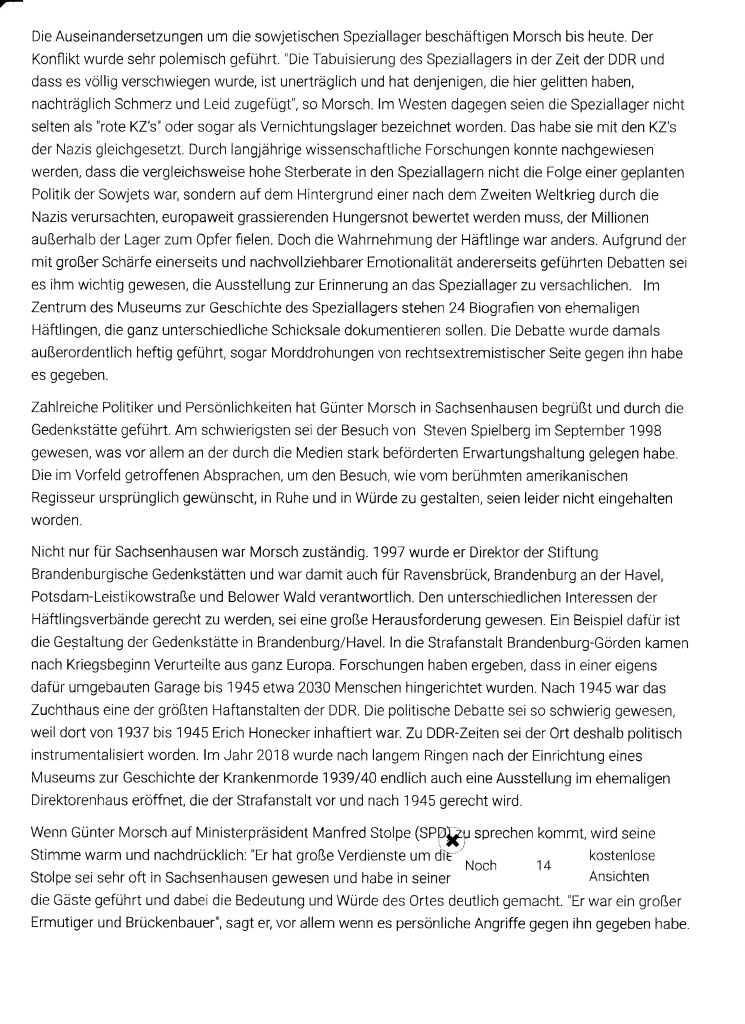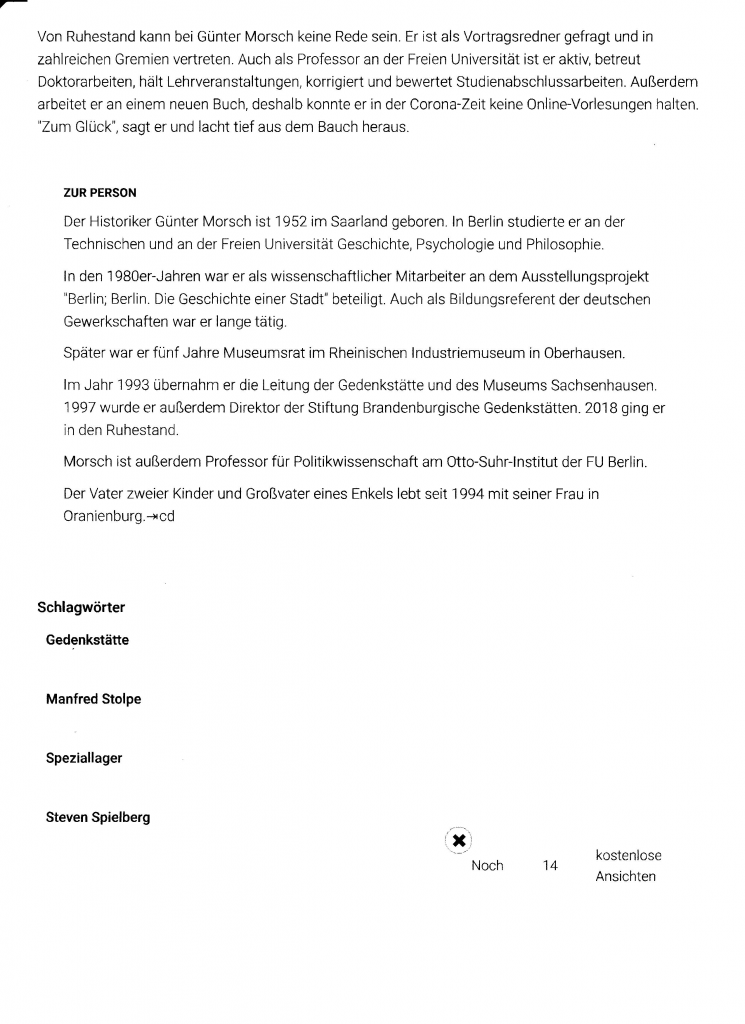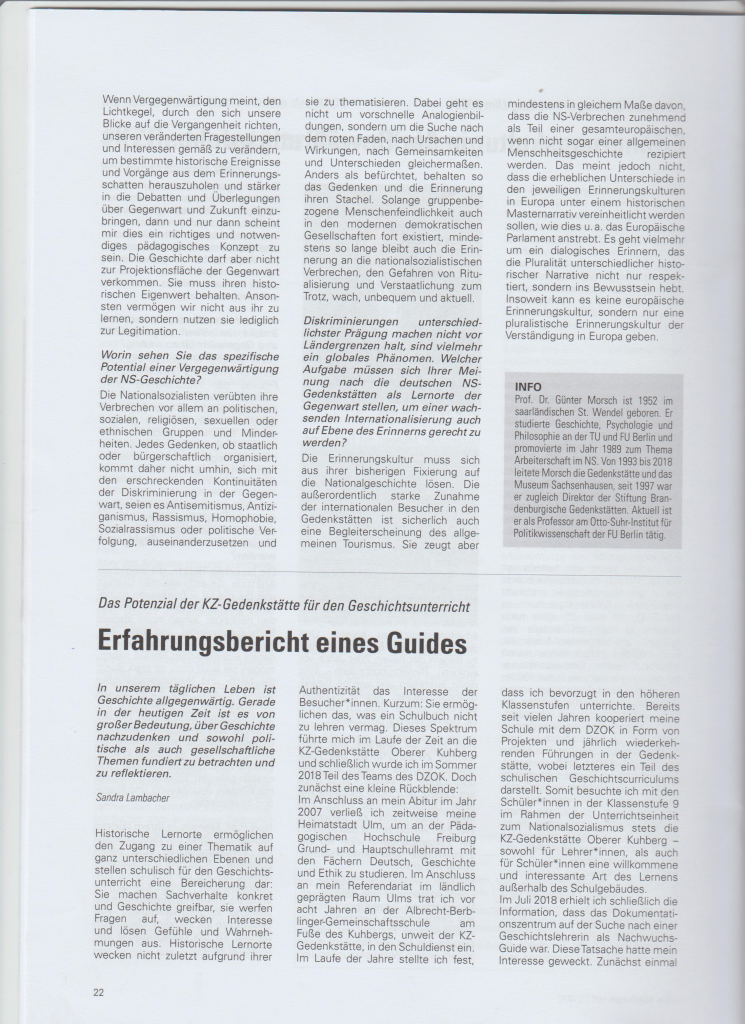Günter Morsch leitet seit 1993 die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen, seit 1997 ist er Direktor der Stiftung Brandenburger Gedenkstätten. Wenn er Ende Mai in den Ruhestand geht, hat er dort viel erreicht – allerdings auch einiges im Zustand der Gedenkstätten zu beklagen. Vor allem wundert ihn, dass Sachsenhausen, das ehemalige „KZ bei der Reichshauptstadt“ bisher im Bewusstsein vieler Berliner nicht zu einer Berliner Gedenkstätte und nicht zu einem Bestandteil Berliner Geschichte geworden ist
taz: Wie haben sich Sachsenhausen und die Brandenburgischen Gedenkstätten seit den 1990er entwickelt?
Günter Morsch: Es gab damals so gut wie keine wissenschaftliche Forschung, der Bauzustand der historischen Relikte und der DDR-Denkmäler war ein Desaster, die Ausstellungen waren dringend überarbeitungsbedürftig. Wir haben die Gedenkstätten zu modernen zeithistorischen Museen mit besonderen humanitären und bildungspolitischen Aufgaben weiterentwickelt, was dann zu einer gewissen Vorbildfunktion für andere wurde. Vor allem ging es darum, die Geschichte von Sachsenhausen insgesamt zu erzählen: die des NS-Konzentrationslagers, die Phase des sowjetischen Speziallagers, die in der DDR völlig tabuisiert war, und schließlich, wie die Gedenkstätte in der DDR-Zeit entstanden ist.
Sachsenhausen ist 1936 gegründet worden als „Konzentrationslager bei der Reichshauptstadt“. Wie war die Verbindung zwischen Berlin und Sachsenhausen?
Schon ab 1933 kam die politische, künstlerische und intellektuelle Elite Berlins zu einem großen Teil in das KZ Oranienburg. Und 1936, während Millionen Menschen auch aus dem Ausland Berlin besuchten und über die Olympiade jubelten, wurde Sachsenhausen als völlig neues, Himmler sagte, „modernes Konzentrationslager“, aufgebaut. Man wollte die kleinen Lager, etwa Papestraße oder Columbiadamm, aus der Stadt herausschaffen, so, wie man zur Olympiade auch alle Sinti und Roma nach Marzahn verschleppte, die später auch zu einem großen Teil nach Sachsenhausen kamen. Das Konzentrationslager wird mit Absicht bei der Reichshauptstadt gegründet.
Warum wollte man ein Konzentrationslager bei Berlin aufbauen?
Das hat etwas mit der Ansicht aller traditionellen Führungseliten zu tun, dass Berlin als rote Hauptstadt eine Gefahr für den von Anfang an geplanten neuen Krieg sei. Das Militär, weniger die NSDAP, wollte dicht bei Berlin ein großes Lager für dieses aufständische, querulatorische Volk. Nach der so genannten Reichskristallnacht kam der überwiegende Teil der über 6000 Juden, die nach Sachsenhausen verschleppt wurden, aus Berlin. 1939 wurden die so genannten polnischen und staatenlosen Juden aus dem „Scheunenviertel“ unter pogromartigen Begleitumständen über die Bahnhöfe Berlins nach Sachsenhausen transportiert. Umgekehrt entstanden ab 1942 mitten in Berlin insgesamt ca. 30 Außenlager.
Wo sind heute noch Spuren dieser Außenlager in Berlin zu sehen?
Häufig hat man die Spuren beseitigt. Beim Außenlager Lichterfelde engagiert sich eine Bürgerinitiative, dort gibt es regelmäßige Gedenkveranstaltungen, in Spandau gibt es eine Geschichtswerkstatt. Aber ein großer Teil der Außenlager ist bis heute nicht markiert.
Woran liegt das?
Diese Orte liegen meistens in Industriegebieten, weniger in Wohnvierteln, und sie sind nur noch schwer auffindbar. Umso wichtiger ist es, dass Berlin sie systematisch kennzeichnet. Es gibt auch kaum einen Friedhof in Berlin, auf dem nicht Häftlinge von Sachsenhausen liegen, weil Sachsenhausen erst ab 1940 ein eigenes Krematorium hatte. Diese Friedhöfe haben wir umfangreich dokumentiert, auch da würde ich mir wünschen, dass es endlich gemeinsam mit Berlin eine Kennzeichnung dieser Gräber und eine entsprechende Broschüre gibt. Aber leider sind wir immer wieder daran gescheitert, dass die Bezirke für die Friedhöfe zuständig sind, und wir können nicht mit allen Bezirken einzeln reden. Oder nehmen Sie den Ort, an dem wir das Interview führen, das T-Gebäude. Es war ab 1938 Sitz der Inspektion der Konzentrationslager. Es ist der wichtigste noch vollständig original erhaltene Ort der Schreibtischtäter. Das ist in Berlin weitgehend unbekannt. Sachsenhausen hat nach wie vor in Berlin nicht den Stellenwert, wie das für Dachau in München inzwischen selbstverständlich ist.
Sachsenhausen ist bisher also nicht zu einer „Berliner Gedenkstätte“ geworden. Warum nicht?
Da scheint nicht selten immer noch die Mauer im Kopf wirksam zu sein. Wir stellen leider nach wie vor die Vorherrschaft einer Geschichtsinterpretation fest, die sehr stark aus der Sicht Westdeutschlands und West-Berlins bestimmt wird. Vor allem die“ Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“ hat systematisch versucht, die Geschichte des Konzentrationslagers in Vergessenheit zu bringen und stattdessen das so genannte „Rote Konzentrationslager“ zwischen 1945 und 1950 in den Vordergrund gestellt. Diese Sicht auf die Geschichte war im kalten Krieg dominierend und hat sogar jemanden wie Willy Brandt ergriffen.
Inwiefern?
Die SPD im Vorfeld der Gründung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte 1961 in Bad Godesberg eine Art Gegenkongress abgehalten, und in der Rede des Regierenden Bürgermeisters kommt mit keinem Wort das Konzentrationslager vor, obwohl Menschen wie Julius Leber, den er selbst als Lehrer immer verehrt hat und viele andere Sozialdemokraten, nicht zuletzt aus Berlin, in Sachsenhausen waren. Stattdessen behauptete er, dass die Mehrheit aller Häftlinge des ehemaligen „roten Konzentrationslagers“ Sozialdemokraten gewesen wären. Unsere Forschungen zeigen heute ein ganz anderes Bild. Unter 60.000 Häftlingen im sowjetischen Speziallager konnten wir nur wenig mehr als 100 Sozialdemokraten identifizieren. Das sind die Mythen, die teilweise weiterleben und das setzte sich auch nach der deutschen Einheit fort.
Kommen mehr Schulen aus Ostdeutschland nach Sachsenhausen?
Die Anzahl der Brandenburger Schulgruppen steigen nach wie vor an, der Zuspruch der Schulen aus Berlin ist dagegen insgesamt seit 2006 stark gesunken. Das geht allerdings nicht nur Sachsenhausen so, auch an Orten wie dem Haus der Wannseekonferenz bleiben Schulgruppen aus Berlin vermehrt weg.
Wie erklären Sie sich das?
Die Bedingungen für Gedenkstättenbesuche haben sich deutlich verschlechtert und es ist schwierig, mit den dezentralen, bezirklichen Schulverwaltungen zu kommunizieren. Gut, dass mit dem Vorstoß von Sawsan Chebli wieder über die Beziehung zwischen Schulen und Gedenkstättenpädagogen diskutiert wird, man muss aber keine Pflichtbesuche einführen, man sollte die Bedingungen verbessern.
Wie sollte das Erinnern und Gedenken heute aussehen?
Im vergangenen Jahrzehnt haben sich die Lernformen verändert und wir müssen unsere Fragestellungen anpassen, stärker von den Opfern auf die Täter fokussieren, denn in ihren Strukturen, in ihren Mentalitäten liegen die Ursachen für den Terror. Aber die Gedenkstätten sind im Vergleich zu großen Museen finanziell und personell immer noch unterprivilegiert. Wir haben zwar viele Honorarkräfte, die wir für Führungen einsetzen, aber wir können die vielen, interessierten Menschen aus aller Welt gar nicht so betreuen, wie wir das wollen. Ein oder zwei Tage, idealerweise eine ganze Wochen an diesem Ort zu lernen, ist viel nachhaltiger, als in zwei Stunden einmal über das Gelände geführt zu werden. Letzteres ist eine wenig diskursive, lebendige und dialogische Pädagogik, wie wir sie uns wünschen.
Wie würden Sie die Vermittlung angehen?
Wir setzen auf selbstständiges Lernen, gehen auf Interessen und unterschiedliche Bewusstseinslagen ein. Wir haben ja mit Absicht keine große, mehrere tausend Quadratmeter umfassende zentrale Ausstellung, sondern spezifische, kleine Museen in den authentischen Gebäuden, zum Beispiel zu der Frage, die sich noch immer aus der Bewältigung der eigenen Familienerzählungen ergibt: was wusste eigentlich die Umgebung? Oder was zeichnet die Täter in ihren Biographien aus? Was uns vielfach fehlt, sind Zeit und Personal, um dies intensiv mit vielen Gruppen über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten.
Sie entwickeln auch eine Handy-App, wie wichtig sind solche Medien, um junge Menschen zu erreichen?
Natürlich müssen auch moderne Gedenkstätten in ihren Präsentationsformen mit der technischen Entwicklung Schritt halten Viele Besucherinnen und Besucher, gerade junge Menschen, beurteilen Museen nach dem Internetauftritt. Allerdings interessieren sich auch die Jugendlichen hauptsächlich für die dinglichen Artefakte in unseren Museen und weniger für die Medien, als man gemeinhin annimmt. Mit der App, mit der man die Außenlager in Berlin erkunden kann, wollen wir diejenigen stärker interessieren, die sich fragen, was vor ihrer Haustür, in Wilmersdorf oder in Lichterfelde, geschah.
Jenseits von der Forderung nach Pflichtbesuchen bleiben Gedenkstättenbesuche also wichtig.
Gedenkstätten sind wichtige Mosaiksteine der historisch-politischen Bildung. Aber wir dürfen uns angesichts des vielfachen Lobs nicht zurücklehnen, sondern unsere pädagogischen Angebote immer überprüfen, ob sie noch die aktuellen Fragen von jungen Menschen aufgreifen. Leider ist das Koalitionsabkommen der neuen Regierung für uns eher enttäuschend. . Gegenüber anderen Museen, die von Fläche und Besucherzahl vergleichbar sind, sollen die NS-Gedenkstätten offenbar nach wie vor deutlich unterprivilegiert bleiben.
Wie würden Sie Sachsenhausen stärker im Berliner Bewusstsein verankern?
Im so genannten Humboldt-Forum soll eine stadtgeschichtliche Ausstellung entstehen, die wohl vor allem Berlins Rolle in der Welt thematisiert. Ich würde mir wünschen, dass Sachsenhausen daran einen relevanten Anteil hat. In Sachsenhausen waren Häftlinge aus 40 Nationen und aus zahlreichen Gruppen, hier waren die späteren Repräsentanten ganzer Nachkriegsregierungen inhaftiert: in Norwegen z. B. kamen bis in die 70er Jahre vom Ministerpräsident bis zum Sozialminister alle aus Sachsenhausen. Wenn man die Beziehungen von Berlin zu europäischen Ländern verstehen will, muss man begreifen, welche Rolle Sachsenhausen dabei spielt .